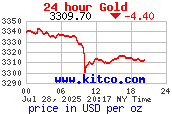Eine interessante Zusammenfassung, was bisher passiert ist - und wie es soweit kommen konnte. Gefunden bei tages-anzeiger.ch:
09. November 2007, 20:21 – Von Constantin Seibt
Was zum Teufel ist los mit den Finanzmärkten?
Milliardenverluste bei den Banken, die UBS in der Krise, ihr Chef am Abgrund. Was ist passiert? Ein kurzer Crash-Kurs zur Hypotheken-Krise.
«Wenn du nicht weisst, wer der Trottel am Tisch ist, dann bist wahrscheinlich du es.»
Altes Poker- und Börsensprichwort
Was zum Henker ist los? Die UBS, solide im Ruf, schreibt vier Milliarden Franken ab. Und nun befürchten Experten bis zu weiteren acht Milliarden Verlust. Die Citigroup, grösste Bank der Welt, benötigt laut Analysten dringend 30 Milliarden zusätzliches Kapital. Die Investmentbank Merrill Lynch sprach Ende August von 3 Milliarden Abschreibern nur Wochen später erhöhte sie auf 8,4.
Damit hat die seit Ende Juli schwelende Hypotheken-Krise – mitten in einer boomenden Weltwirtschaft – ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Ein amerikanischer Hedge-Fonds-Manager sprach von einem Vorgang wie beim Dynamit-Fischen: «Zuerst erwischt es die kleineren Fische, die dann tot an der Oberfläche treiben. Die grösseren brauchen länger zum Sterben.»
In der Tat hatte es zuerst ein paar kleine, graue Fische erwischt: zwei mittelgrosse Hedge-Fonds in den USA. Zwei deutsche Banken, darunter die Sächsische Landesbank. Und eines Morgens, als die Würzburger Bevölkerung aufwachte, las sie in der Zeitung, dass ihre braven Stadtwerke einen Millionenverlust mit Derivaten eingefahren hatten.
Überraschenderweise sagten alle, vom bleichen Chef der Stadtwerke über den bleichen Chef der Sächsischen Landesbank bis zum kaltblütigen UBS-Topbanker Marcel Ospel, dasselbe. 1. «Niemand konnte das kommen sehen!» 2. «Wir dachten, dass die Produkte, die wir gekauft hatten, todsicher seien!» 3. «Niemand kann genau sagen, wie hoch die Verluste wirklich sind.»
Was ist passiert? Und wie kann es so verschiedene Gewichtsklassen erwischen: vom Stadtwerk bis zur UBS? Ausgerechnet die supervorsichtige, laut ihrem Chef Marcel Ospel «schon fast übertrieben risikoaverse» Grossbank? Und stimmt es, dass es niemand kommen sah? Und warum haben selbst Profis keinen Überblick?
Die Ursache der meisten Finanzkrisen ist im Prinzip simpel: eine Spekulationsblase platzt. Und sie erwischt die langsamsten und die gierigsten Teilnehmer – die naiven Heringe plus die fresslustigen Haifische. So weit, so einfach. Der interessante Teufel steckt dann im Detail. Im Fall der Hypothekenkrise in Derivaten.
Mr. Greenspans Hypothek
Im Prinzip startete die Hypotheken-Blase wie folgt: Nach dem Platzen der New-Economy-Blase 2001 setzte der Notenbankchef der USA, Alan Greenspan auf eine klare Politik. Sicher, Mr. Greenspan pflegte zwar einen berühmt vagen Redestil. («Ich weiss, dass Sie glauben, was ich Ihrer Ansicht nach gesagt habe. Aber ich bin mir nicht klar, ob Ihnen klar ist, dass das, was Sie gehört haben, nicht das ist, was ich meine.») Aber seine Politik war glasklar: Er senkte die Zinsen. Geld wurde sehr, sehr billig. Und damit stieg die Investitions- wie die Risikobereitschaft von kleinen wie grossen Marktteilnehmern.
Für die grossen Fische hiessen niedrige Zinsen: Milliardeninvestitionen, Milliardenspekulationen, Milliardenübernahmen. Die einfachen Amerikaner hingegen kauften sich Häuser. Die Banken finanzierten, der Markt boomte, die Hauspreise stiegen fast monatlich. Schliesslich, ab etwa 2004, hatten die meisten ihr Haus, bis auf eine Gruppe, die Mittellosen. Nun wurden auch ihnen Häuser verkauft – oft mit Lockvogelzinsen, die sehr niedrig begannen und nach ein, zwei Jahren mörderisch anstiegen. Verkauft wurden die Häuser den Armen als Investition, mit dem Argument, dass bei den steigenden Hauspreisen gar nichts schief gehen könnte: Selbst wenn man die Zinsen nicht zahlen könne, würde man einfach sein Haus verkaufen können – mit sicherem Gewinn.
Es war ein klassisches Schneeballsystem, nur legal und in gigantischen Ausmassen. Als es im Frühsommer 2007 zusammenbrach, war die Hölle los: erst bei den Mittellosen, dann beim Mittelstand. Denn dieser hatte die immer wertvolleren Häuser bis unters Dach mit immer höheren Hypotheken belehnt - und das Geld für Luxusprodukte ausgegeben. Allein seit 2003 nahmen die amerikanischen Haushalte 4800 Milliarden Dollar Schulden auf – der Löwenanteil gedeckt durch ihre Häuser.
Dann platzte die Blase. Seit Juli sackten die Hauspreise um 30 Prozent. Trotzdem fanden sich kaum Käufer. Die Bilanz ist verheerend: Bis Ende 2008, so schätzt die amerikanische Regierung, werden 2 Millionen Hypotheken nicht bezahlt werden. Das heisst: 2 Millionen Familien werden ihr Haus zwangsversteigern müssen, gedemütigt, verschuldet, mit unklarer Zukunft.
Mmh – Gammelfilets!
Dabei warnten Ökonomen seit Jahren - mit drastischen Worten wie «Häuserblase», «Kreditkatastrophe» und «finanzielle Massenvernichtungswaffen».
Warum reagierte niemand? Weder Regierung noch Banken? Was die Regierung betrifft, ist der Grund einfach: «Ideologie», schrieb der amerikanische Ökonom Paul Krugman: «In Washington regieren Leute, die nie in den Markt eingreifen, weil für sie immer der Staat, nie der Markt das Problem ist.»
Und der Markt? Warum gaben die sonst so pingeligen Banken bedenkenlos Kredit? Weil sie ein System gefunden hatten: Sie trugen die Kreditrisiken nicht selber, sondern verpackten sie in komplexe Finanzprodukte, so genannte Derivate. Diese Derivate verkauften sie ihren Kunden als Anlageprodukt weiter. Dabei mixten sie hochriskante Kredite mit ziemlich sicher zurückgezahlten Schulden. In einem Wort: Sie vermischten Gammelfleisch mit Filetstückchen.
Diese Mischung wurde als was verkauft? Als Filetstückchen. Dies dank der Rating-Agenturen. War die Mischung raffiniert genug, erhielt das Derivat die Höchstnote: AAA – das Zertifikat steht für höchstmögliche Kreditsicherheit. Diese AAA-Derivate verkauften sich blendend. Denn im Gegensatz zu herkömmlichen AAA-Anlagen hatten sie einen verführerischen Köder: einen hohen Zins, der mehr Rendite versprach als alle Konkurrenzprodukte. Und als AAA galten diese Produkte für unbedenklich – also kaufbar für Pensionskassen, biedere Sächsische Landesbanken und auch die Würzburger Stadtwerke.
Kurz: Das perfekte Produkt für gierige Naive, die sich über den hohen Zins freuten, das Kleingedruckte nicht verstanden und nicht wussten, dass sie eine Zeitbombe im Tresor hatten.
Als die Krise dann ausbrach, erwischte es aber neben den Kunden auch die Banken: Denn die sassen noch auf riesigen Lagerbeständen ihrer Zeitbomben, als diese fast über Nacht unverkäuflich wurden.
Was genau die Blase zum platzen brachte, war eine Kleinigkeit: zwei französische Fonds mit Hypothekenderivaten meldeten vorübergehend Zahlungsschwierigkeiten. Das reichte, um Jahre der Euphorie zu vernichten. Plötzlich setzte Misstrauen ein. Und verbreitete sich innert Stunden über die Finanzinstitute des Erdballs. Die Wirkung war radikal: plötzlich kaufte kein Mensch mehr Hypothekenderivate. Der Markt war von einem auf den nächsten Tag tot.
Und niemand wusste mehr, wie viel wirklichen Wert die Papiere noch hatten: Wie viel gute und schlechte Schuldner, wie viel Filet, wie viel Gammelfleisch steckte in den einzelnen Dingern? Die Antwort war keine gute: ihre Mischung war zu komplex, um das sagen zu können.
Und deshalb, ebenso über Nacht, vertrauten sich die Banken nicht mehr. Niemand wusste, wie viel faule Kredite der andere im Portefeuille hatte. So kam es, dass Ende Juli 2008 – nach Jahren des Börsenhochs und der Milliardengewinne! – selbst Grossbanken plötzlich keinen Kredit bei Grossbanken hatten.
Eine akute Vertrauenskrise drohte das globale Finanzsystem lahmzulegen. Und so kam es, dass die Zentralbanken der Welt notfallmässig erneut Zinsen senkten – die Notfallkur bestand aus dem gleichen Rezept, das den Zirkus überhaupt in Schwung gebracht hatte: Dutzende Milliarden frisches Geld wurden in das System gepumpt.
Nur: War das alles wirklich neu: Die Blase? Die AAA-Ratings für Zeitbomben? Die Undurchschaubarkeit der eigenen Finanzprodukte?
Die Sache mit den Ratings war keine wirkliche Überraschung: Immerhin hatte Thailand, noch fünf Monate, bevor es 1997 bei der Asienkrise fast bankrott ging, ein AAA-Rating. Der amerikanische Energiekonzern Enron galt als AAA bis zur Vorwoche seines Bankrotts. Der Haupttrick, für die Hypotheken-Derivate ein AAA zu bekommen, lief dabei wie folgt: Die Banken warfen Tausende von Hypothekarschuldnern in einen Topf. Dann gaben sie drei Klassen von Papieren heraus: Solche mit hohem, solche mit mittlerem Risiko und solche mit AAA-Rating. Platzten einige der Schulden, kamen zuerst die Käufer der Hochrisikopapiere an die Kasse dann nach einer gewissen Schwelle die mit mittlerem Risiko. Und dann die AAA-Papiere. Es funktionierte wie die Architektur eines dreistöckigen Hauses: zuerst werden die unteren, dann die mittleren Stockwerke überflutet, aber die Bewohner im AAA-Obergeschoss theoretisch nie.
Nur dass die Flut von nicht bezahlten Hypotheken rasant anstieg – weil immer mehr schlechte Schuldner an Bord geholt wurden. Am Ende hatten 20 Prozent der neuen Hausbesitzer ihren Kauf zu 100 Prozent fremdfinanziert.
Warum aber spielten die Rating-Agenturen mit? So hoch angesehene Firmen wie Moody s oder Standard & Poor’s? Rating-Agenturen sind private Firmen, die vom Geprüften selbst bezahlt werden. Seriosität gehört zwar zum Geschäft. Aber allzu pingelige Strenge würde die Kunden vertreiben. Und das Derivate-Benoten ist das neue Kerngeschäft für die Rating-Agenturen: Es bringt über 50 Prozent des Umsatzes. Kein Wunder, dass auch über 50 Prozent aller Hypothekenderivate das todsichere AAA-Rating bekamen.
Die Misserfolgs-Versicherung
Und Derivate als Zeitbomben? Auch das war nicht sehr neu. Im Prinzip sind Derivate schon seit Jahrhunderten bekannt – und meistens dienen sie nicht der Spekulation, sondern ihrem Gegenteil: der Versicherung.
Die Grundidee ist raffiniert einfach: Wer in einem Geschäft ein hohes Risiko hat, wettet auf das Misslingen seines Geschäfts. Also etwa eine Ölfirma auf Sinken des Ölpreises, ein Bauer auf billige Getreidepreise, ein grosser Aktienbesitzer auf Sinken der Kurse. Geht alles gut und das Hauptgeschäft boomt, verliert er zwar diese Wette. Läuft das Geschäft aber schief, sind seine Verluste begrenzt. Derivate sind eine Versicherung gegen geschäftlichen Misserfolg.
Formal finden diese Wetten als Termingeschäft statt: Man verpflichtet sich gegen eine Gebühr (quasi die Versicherungsprämie), in Zukunft etwas zu einem vorher festgesetzten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Oder man kauft nur die Möglichkeit, etwas in Zukunft zu einem festen Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Diese einfachen Derivatformen lassen sich beliebig kombinieren – bis zur endlosen Komplexität. Gewettet werden kann prinzipiell auf alles – auf Aktien, Börsenindizes, Rohstoffpreise, Währungskurse, sogar andere Derivate. Oder auf das Verhältnis zwischen ihnen.
Dadurch können Finanzprofis Geschäfte so präzis versichern wie nie zuvor. Allerdings können sie sie auch undurchschaubar werden wie nie zuvor. Die Komplexität gibt den Derivat-Spezialisten einen enormen Vorteil in die Hand: Die Kunden verstehen nicht ganz. Es lassen sich so auch hochriskante, sogar bösartige Produkte herstellen – um Anleger, Steuer, Kontrolleure oder die Buchhaltung irrezuführen.
Der Witz etwa bei riskanten AAA-Hypotheken-Derivaten war nicht zuletzt, den Banken ein enormes Risiko vom Hals zu halten und am Verkauf noch zu verdienen. Auf der anderen Seite erlaubten die Hypothekenderivate ihren Käufern, ehrgeizigen Pensionskassenverwaltern oder Firmenfinanzchefs, durch den fetten Zins riskante, aber profitable Wetten einzugehen. (Und dabei ganz harmlos auszusehen: In den Büchern steht dann ein unschuldiges AAA-Produkt.)
Das geht manchmal schief. Einer der frühesten Unfälle war 1995 die Pleite von Orange County, einer reichen Rentnersiedlung in Florida. Deren Finanzverwalter Robert Citron hatte sich von einer Investmentbank für 20 Milliarden Dollar (davon 13 auf Pump) exotische Derivate andrehen lassen: sogenannte Reverse Floater. Damit waren die 1 Million Einwohner eine Wette auf fallende Zinsen eingegangen bei jedem steigenden Zinspunkt verlor der Bezirk 270 Millionen Dollar. Als die Zinsen stiegen, begann Citron zwischen den Zähnen zu pfeifen und konsultierte Hellseher. Es half nichts. Ende 1995 war Orange County pleite: Sie hatten 1,7 Milliarden Dollar verloren.
Die Taschenrechner
Aber Zwischenfälle wie dieser irritierten nur kurz. Dazu waren Derivate in den neunziger Jahren schlicht das zu heisse Ding. Steile Karrieren wurden gestartet – und das Personal in der Bank änderte sich. Plötzlich betraten ganze Rudel von Mathematikern die Bank: Hi-Tech-Magier, beargwöhnt von den hemdsärmligen Händlern. Ebenso waren Mathematiker und ihre Modelle das Gehirn hinter den neuen immer mächtigeren Gebilden, die sich in der Finanzwelt vermehrten: Hedge-Fonds bündelten die Milliarden von Banken und Pensionskassen und investierten sie in komplexe Derivatgeschäfte, die kleine Kursschwankungen ausnützten.
In den späten 1990er-Jahren war der Hedge-Fonds LTCM – Long Term Capital Management – der strahlende Koloss der neuen Finanzwelt. Er hatte nicht nur die höchsten Renditen (über 20 Prozent), sondern spekulierte auch mit gigantischen Summen: bei einem Kapital von 4 Milliarden Dollar hatte er Fremdgelder von 120 Milliarden aufgenommen.
Und er hatte die berühmtesten Derivat-Mathematiker im Verwaltungsrat: die Nobelpreisträger Robert Merton und Mylon Scholes – die beiden hatten 1973 die Formel entwickelt, wie man Derivate bewerten konnte. Neben Merton und Scholes hatte nur noch einer die Entwicklung des neuen Finanzzeitalters ähnlich vorangetrieben: der ein Jahr zuvor erschienene HP-35-Taschenrechner, der die schnelle Berechnung der Formeln erst möglich machte.
Und auch der Chef von LTCM war eine Legende: John Meriwether, ein heissblütiger Wall-Street- Händler, der berüchtigt dafür war, 100’000 Dollar auf einen Münzwurf zu wetten – oder eine Million auf ein Rennen zwischen zwei Hummern aus dem Restaurant-Aquarium.
Die Investoren – die mächtigsten Banken – bettelten darum, bei LTCM investieren zu dürfen. Sie wurden alle kühl behandelt. Unter 100 Millionen Dollar Beteiligung lief nichts – und auch dann, war es eine Gnade investieren zu dürfen.
Mathis Cabiallavetta, der Chef der UBS schaffte es: Er durfte sogar eine Milliarde investieren.
Das Ende eines Verräters
Cabiallavetta war einer der jungen Händler gewesen, der die Zeichen der Zeit erkannt hatte: Derivate. Er wurde in den neunziger Jahren Chef der jungen Derivateabteilung der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) – und obwohl er wenig Ahnung von dem mathematischen Krimskrams hatte, baute er sie (und damit seine Machtbasis in der Bank) rasant aus.
Und es gelang: Die Derivateabteilung machte exorbitante Gewinne, Cabiallavetta galt als der neue Mann und wurde 1996 CEO der SBG.
Er war kaum ein Jahr im Amt, als die Bombe hochging: 680 Millionen Franken Verlust in der Derivatabteilung. Er hatte sie mit Tempo Teufel ausgebaut – und dabei die Risikokontrolle vernachlässigt. Nun stand seine Karriere auf der Kippe. Erste Rivalen hoben die Köpfe.
Cabiallavetta handelte kalt, entschlossen, wie eine Shakespeare-Figur: In einem kühnen Zug liquidierte er die eigene Bank. Er stimmte einer Fusion mit dem Bankverein zu. Die Verhandlungen verliefen atemberaubend schnell. Cabiallavettas einzige ernsthafte Bedingung schien: der Chefposten für ihn. Der Rest war eine Kapitulation der grösseren SBG – sie wurde durch den kleineren Bankverein übernommen. In der neuen UBS sassen auf allen Schlüsselpositionen die Getreuen des Bankverein-Chefs Marcel Ospel.
Und Cabiallavetta brauchte dringend Erfolg: Er überliess LTCM eine satte Milliarde, blind, ohne Bedingungen, ohne Kontrolle – in der Hoffnung, dass LTCM weiter 20-Prozent-Profite machen würde.
Doch dann passierte etwas, was laut den LTCM-Mathematikern höchstens einmal in 1 Million Jahren hätte stattfinden dürfen. Verunsichert von der Wirtschaftskrise in Russland, schichteten auf einmal riesige Pensionskassen riesige Summen in langweilige Staatsanleihen um. Das war statistisch nicht vorgesehen. LTCM hatte auf ein leichtes Sinken dieses Kurses gewettet. Nun stieg er, wie er nie hätte steigen dürfen. Und mit jedem Zehntelprozent verlor LTCM Millionen – schliesslich das gesamte Eigenkapital über vier Milliarden.
Doch der Koloss war zu gross, um zu sterben. Da die Finanzwelt befürchtete, ein bankrotter LTCM könne die halbe Weltwirtschaft mitreissen, schossen die beteiligten Banken unter der Führung von Alan Greenspan noch einmal zähneknirschend 3,75 Milliarden Dollar ein.
Der einzige, der bei LTCM gefeuert werden konnte, war der Boss: John Meriwether. Doch die Mathematiker, Finanzprofis, Informatiker waren nicht ersetzbar. Ohne sie hätte niemand die komplizierten Geschäfte verstanden. Sie weigerten sich, weiter zu arbeiten, falls ihnen nicht dicke Weihnachtsboni ausbezahlt würden. Sie bekamen sie – als Dank für vier Milliarden Verlust.
Uubs, they did it again!
Auch Cabiallavetta wurde gefeuert; Marcel Ospel war der Nachfolger. Zurück blieb im Herbst 1998 eine blamierte UBS mit Bankverein-Chefs und hasserfüllten Ex-Bankgesellschaft-Leuten. Die Bank war von den Kämpfen gelähmt und verpasste den New-Economy-Boom total – dafür machte die Credit Suisse auf den neuen Märkten Tempo, Geschäfte, Geld und Ehre. Liest man die Presse von damals, sind die Artikel voll mit Spott über die träge UBS und Lob der dynamischen CS.
Dann platzte 2001 die Internet-Blase und die CS sass tief in Problemen, Prozessen und roten Zahlen. Die gelähmte UBS hingegen hatte als so gut wie einzige Grossbank der Welt kaum Geld verloren und wurde bejubelt: als vorbildlich solide Bank. Dafür ergoss sich grosszügig Kritik über die verantwortungslose CS.
Der nun strahlende Chef Ospel verlangte Tempo: Die UBS sollte auch in Amerika ganz vorne sein – beim risikoreichen Investmentbanking. Ospel verlangte den Aufstieg in die Top-Liga. Zu diesem Grund gründete die UBS 2005 einen mit über 3 Milliarden dotierten, fast völlig autonomen Super-Hedge-Fonds, bestückt mit den besten Profis des Hauses.
Der Fonds investierte im grossen Stil in das heisseste Ding auf dem Markt: Hypotheken-Derivate. Daneben investierte das in der Mutterbank zurückgelassene frustrierte UBS-B-Team ebenfalls in grossem Stil in das heisseste Ding auf dem Markt: Hypotheken-Derivate. Niemand bemerkte die Doppelung der Risiken. Und so schaffte es die UBS, gleich doppelt Hypotheken-Zeitbomben einzukaufen.
Dafür verlor zur Überraschung aller die noch immer durch die einstigen Niederlagen gelähmte Credit Suisse mit 2,2 Milliarden Franken vergleichsweise wenig. Laut Presse hat sich die CS damit als seriöse Bank gezeigt; aller Spott gilt der UBS. Der schönste Rat kam vom Zürcher-Banking-Professor Hans Geiger, der angesichts von 40 Milliarden Hypothekenderivaten im Tresor der UBS sagte: «Die Bank muss jetzt einfach beten.» Vergangenen Juni noch wählten Finanzprofis Marcel Ospel zum Topstrategen des Jahres. Jetzt verlangen sie seinen Kopf.
Eine zuverlässige Prognose
«Wir haben viel gelernt!», sagte Ospel selbst in einem Interview nach dem Desaster. Nur was?
Nun, nicht viel Neues. Ein weiteres Mal taucht das Risiko, das versucht wurde, so raffiniert wie möglich unter Kontrolle gehalten zu werden, an unerwarteten Stellen wieder auf. Es bleiben die alten Regeln: In einer geplatzten Blase erwischt es immer die Gierigsten und die Naivsten. An der Börse ist das Genie von gestern oft der Volltrottel von morgen. Und mathematisch ausgerichtete Hedge Fonds sind zwar mit den Statistiken der letzten 50 Jahre gefüttert, aber gerade deshalb kommen sie in Gefahr, sobald ein ungewöhnliches Ereignis auftritt. Sorgen muss man sich um die Banken nicht: Je grösser sie sind, desto sicherer kommt die Kavallerie mit Milliardenspritzen.
Und die Wirkungen auf die reale Wirtschaft? Sie sind unklar. Die Fragen sind: Wird der Konsum in Amerika nun zusammenbrechen? Kommt es dann zur Rezession? Nur in den USA oder auch hier? Und wird die Börse noch heftiger crashen? Auch hier liesse sich wetten. Die Chancen stehen 2:1 gegen die Rezession, wenn man dem Modell des Wirtschafts-Nobelpreisträgers Paul Samuelson folgt. Der sagte: «Die Börse hat neun der letzten fünf Rezessionen vorhergesagt.»