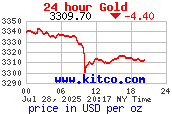In der Süddeutschen Zeitung gab es die vergangenen Tage einige interessante Artikel zum aktuellen Dollarverfall. Um nicht unnötig Postings zu "schinden", fasse ich diese hier zusammen.
Das Dilemma der Scheichs
Die einst bärenstarke US-Währung wird immer schwächer. Das bereitet Schwellenländern und Ölstaaten Probleme.
Von Moritz Koch
Der schwächelnde Dollar beunruhigt nicht nur Europas Exporteure. Die Regierungen vieler Schwellenländer fürchten, dass sie die größten Verlierer der Greenback-Krise sein werden.
Der Grund dafür ist eine Wechselkurspolitik, die den Amerikanern auf der einen und den Asiaten und Arabern auf der anderen Seite über Jahre hinweg zum gegenseitigen Vorteil gereicht hat, nun aber die Schwellenländer mit der Wahl zwischen zwei Übeln konfrontiert: Inflation oder Kapitalverlust.
Die aufstrebenden Nationen Asiens und die Ölproduzenten im Nahen Osten haben ihre Währungen an den Dollar gekoppelt. So machten sie ihre Produkte in den USA billiger und beflügelten ihre Exporte.
Dafür kauften sie US-Schuldverschreibungen, finanzierten so Teile des amerikanischen Konsums und gaben die Souveränität über ihre Zinspolitik auf: Senken die Amerikaner den Preis für Kredite, wie jetzt wegen der Hypothekenkrise, müssen die Schwellenländer nachziehen, um eine Aufwertung ihrer Währung zu verhindern.
Ende der Dollarbindung wäre sinnvoll
Doch was den USA gut tut, ist für Schwellenländer nicht länger das richtige Konjunktur-Rezept: Der dortige Boom hat die Inflation befeuert. Eigentlich wären nun höhere Zinsen und ein Ende der Dollarbindung geboten.
Nur sind da noch die riesigen Devisenreserven, die die Länder angehäuft haben. Eine Aufwertung der heimischen Währung würde unmittelbar den Wert der Ersparnisse schmälern.
Einen Gegenwert von 5700 Milliarden Dollar haben die globalen Devisenvorräte inzwischen, schätzt der Internationale Währungsfonds (IWF). Ein Großteil davon soll in Dollar-Anlagen investiert sein. Allein China, Japan, Taiwan, Süd-Korea, Russland und Indien haben zwei Drittel der weltweiten Reserven gehortet.
Mit ihrer Hamsterstrategie folgten die Länder einem Rat der Weltbank und des IWF: Die Finanzkrisen der späten neunziger Jahre hätten gezeigt, dass Länder sparen müssen, um gegen die Launen der freien Kapitalmärkte gewappnet zu sein.
Doch was als Polster gedacht war, wird nun zur Belastung: China etwa hält nach offiziellen Angaben Devisen im Gegenwert von fast 1500 Milliarden Dollar (Tabelle). Zwar schweigen die Chinesen über die Komposition ihres Währungskorbs. Doch Experten vermuten, dass sie mehr als 60 Prozent in Dollar-Anlagen halten.
Auf dieser Basis hat der Ökonom Nouriel Roubini folgende Rechnung aufgestellt: Wenn der Dollar ein Drittel seines Wertes gegenüber dem Renminbi einbüßt, verpufft in den Büchern der chinesischen Zentralbank Kapital im Wert von mehr als 15 Prozent des chinesischen Inlandsprodukts.
Um die Abhängigkeit vom Dollar zu verringern, haben die Chinesen begonnen, größere Teile der monatlich neu angehäuften Reserven in Euro, Pfund und Yen anzulegen. Auch deswegen ist der Renminbi seit 2005 um etwa acht Prozent gegenüber der US-Währung gestiegen.
"Niemals zuvor so unter Druck"
Doch das sei nicht genug, um die wahre Kraft der chinesischen Währung widerzuspiegeln, urteilen Experten. Zudem erhöhten die künstlich niedrig gehaltenen Zinsen das Risiko von faulen Krediten im Bankensektor.
Kein Wunder also, dass Chinas Führung ihre Sorgen über den Dollar immer deutlicher formuliert. Erst am Montag sagte Premierminister Wen Jiabao: "Niemals zuvor standen wir unter so einem Druck."
Die Ölexporteure haben mit dem selben Problem zu kämpfen. Da Öl in Dollar gehandelt wird, halten auch sie große Greenback-Depots, die zunehmend zur Last werden. Der Opec-Ökonom Mohammad Mazraati schätzt, dass die Opec-Staaten zwischen 1970 und 2004 etwa 73Prozent ihres nominalen Öleinkommens durch Inflation und Dollarabwertung verloren hätten.
Somit überraschen auch die Pläne von Venezuelas Präsident Hugo Chavez nicht, Öl künftig in anderen Währungen zu handeln. Doch ein Ausweg aus dem Dollar-Dilemma sind sie nicht: Je nervöser die Opec reagiert, desto tiefer fällt der Dollar. Und umso wertloser werden die eigenen Reserven.
(SZ vom 22.11.2007/sms)
Der Mythos verblasst
Der schwache Dollar ist nicht nur Diagnose, sondern auch Teil der Therapie: US-Exporte werden billiger, Importe teurer - beides dürfte das milliardenschwere Handelsdefizit verringern.
Ein Kommentar von Nikolaus Piper
Wer eine Währung kauft, erwirbt Ansprüche an eine Volkswirtschaft. Ein Euro repräsentiert ein Stück Europa, ein Franken ein Stück Schweiz, ein Dollar ein Stück Amerika. Im Kurs einer Währung drückt sich daher auch die Meinung von Käufern und Verkäufern über die dahinterstehende Wirtschaft aus.
Was die wichtigste Währung der Welt, den Dollar, betrifft, ist diese Meinung derzeit verheerend. Seit Jahresbeginn hat der Euro mehr als 13 Prozent gewonnen und dürfte demnächst die Schwelle von 1,50 Dollar erreichen; die US-Währung drohte zeitweise ins Bodenlose zu stürzen. Die chinesische Notenbank prüft, ob sie nicht einen Teil ihrer Währungsreserven in Euro umschichten sollte, Öl-Scheichtümer stellen die Bindung ihrer Währungen an den Dollar in Frage.
Der Verfall der US-Währung hat politische und ökonomische Implikationen weit über die derzeitige Finanzmarktkrise hinaus. Bis vor kurzem konnten es amerikanische Politiker mit dem früheren Finanzminister John Connally halten, der seinen europäischen Kollegen einmal sagte: "Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem." So verbrauchen die Amerikaner seit Jahrzehnten viel mehr als sie produzieren. Das US-Leistungsbilanzdefizit hat sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreicht, eine Zahl, bei der in anderen Ländern längst massive Kapitalflucht eingesetzt hätte. Die USA hielten das aus, weil sie sich in der eigenen Währung verschulden konnten. Die Wirtschaft war so dynamisch und die Finanzmärkte waren so leistungsfähig, dass Ausländer mit Freuden ihr Geld nach New York, San Francisco und Houston trugen und so das Defizit finanzierten.
Das hat sich in diesem Sommer geändert. Viele Anleger haben Angst vor einer Rezession in Amerika und, wichtiger noch, sie zweifeln, ob ihr Geld bei der Supermacht wirklich gut aufgehoben ist. Das hat auch mit dem Terrorismus zu tun. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hatte der US-Notenbankpräsident Alan Greenspan die Zinsen stark gesenkt und so eine Panik verhindert. Der Schritt war richtig, doch blieb Greenspan bei der Politik des billigen Geldes auch noch, als die Wirtschaft längst wieder boomte. Damit machte er allerhand Exzesse am Kreditmarkt möglich, absurde Hypothekendarlehen an arme Familien zum Beispiel oder Firmenübernahmen fast ohne Eigenkapital.
Üble Praktiken aufgedeckt
In der Kreditkrise sind solch üble Praktiken aufgeflogen. Die größte Bank Amerikas, die Citigroup, hat sich heftig verspekuliert und sucht jetzt einen neuen Chef. Bei vielen Instituten sind erhebliche Mängel im Risikomanagement aufgetreten. All das drückt den Dollar. Dazu kommt die Führungsschwäche in Washington. Ein Präsident, der sich in einen Krieg verstrickt hat und dem die eigenen Leute davonlaufen, weckt kaum Vertrauen.
Gemessen an der Kaufkraft ist der Dollar heute um 25 Prozent unterbewertet. Solche Zahlen verleiten manch einen zu vorschnellen Schlüssen. Nicht nur Amerika-Feinde wie die Präsidenten von Iran und Venezuela, Ahmadinedschad und Chavez, verhöhnen jetzt die Vereinigten Staaten, auch in Europa träumen manche vom Ende der Supermacht. Sie sollten sich daran erinnern, dass es gerade einmal sieben Jahre her ist, als man für einen Euro 82 US-Cents bekam und über ein Ende der europäischen Gemeinschaftswährung spekuliert wurde. Das stand damals genauso wenig an wie heute der Niedergang Amerikas. Wohl aber dürfte der Dollar seine Rolle als inoffizielle Leitwährung der Welt verlieren. Wenn der Abschied nicht zu abrupt ausfällt, wäre dies eine gute Nachricht für die Weltwirtschaft - und für die USA.
Zunächst einmal ist der schwache Dollar nicht nur Diagnose, sondern auch Teil der Therapie. US-Exporte werden billiger, Importe teurer - beides wird das Handelsdefizit verringern. Einige gefährliche Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft dürften sich jetzt leichter beheben lassen. China hat seine Währung immer noch an den Dollar gebunden, weil die Führung in Peking hofft, mittels eines unterbewerteten Renminbi den Exportboom aufrechterhalten zu können. Je billiger der Dollar wird, desto mehr steigt die importierte Inflation in China und so der Druck, zu einer verantwortungsvollen Währungspolitik überzugehen. Der Euro wird den Dollar zwar nicht ablösen, dessen Rolle als zweitwichtigste Währung dürfte aber stärker werden.
Auch in einem multipolaren Weltwährungssystem werden die USA eine Wirtschaftssupermacht bleiben - vorausgesetzt, ihre Politiker ziehen die richtigen Schlüsse: Sie müssen die hausgemachten Probleme selbst lösen, ohne auf unbegrenzten Kredit in der Welt bauen zu können. Kurzfristig stehen dabei eine verbesserte Finanzmarktregulierung und Hilfen für betrogene Hypothekenschuldner an. Noch wichtiger ist mittelfristig die Sanierung des Staatshaushalts. Ähnlich wie in Deutschland drohen in Amerika die sozialen Sicherungssysteme unter der Last der demographischen Veränderung zusammenzubrechen. Die Regierung von George W. Bush hat die Probleme ignoriert, Geld schien ja keine Rolle zu spielen. Der nächste Präsident oder die Präsidentin könnten das Drama um den Dollar nutzen, um die nötigen, unpopulären Schritte durchzusetzen.
(SZ vom 23.11.2007/mah)
Leitwährung in der Krise
Ein Nachruf auf den Dollar
Für eine Handvoll Dollar konnte man früher nicht nur im Wilden Westen fast alles bekommen. Das hat sich geändert, der rapide Verfall des Wertes in den letzten Wochen ist dafür nur ein Zeichen. Sicher ist: Wer sich auf die Stärke der einstigen Leitwährung verließ, der ist verlassen.
Von Jörg Häntzschel
D-Mark? Lire? Franc? Das waren banale Zahlungsmittel für Krämerseelen, gut, um eine Schachtel Zigaretten oder eine Zeitung zu zahlen. Der Dollar hingegen ist die Währung, deren Kurs immer höher stand als der aufgedruckte Nennwert. Seiner Bedeutung als Leitwährung entsprach eine ebenso bedeutende symbolische Rolle: Der Dollar stand für den Traum von einem Reichtum, mit dem man Freiheit bezahlen konnte. Und die Macht und Potenz, die damit einhergehen.
Ein dicker Dollarstapel in der Hose, so demonstrieren es unendlich viele Filmhelden, genügt, um sich die Welt gefügig zu machen. Schon die Häufigkeit allein, mit der Dollarscheine im amerikanischen Film zu sehen sind, ist bemerkenswert.
Während im europäischen Film das Geld zum Verschwinden neigt, auf die Bank getragen oder gehamstert wird, führen Amerikas Filmhelden einen faszinierenden wie schockierenden Umgang mit dem Geld vor: Es will ausgegeben werden, denn mit jedem verteilten Schein wächst der Ruhm und die Größe seines ehemaligen Besitzers. In Amerikas Kultur, das entdeckten die Europäer im Kino, durfte ungehemmt über Geld geredet, ungehemmt mit Geld spekuliert werden.
Schon die Filmtitel - "Für eine Handvoll Dollar", "The Six Million Dollar Man" oder einfach "$" (1971, mit Warren Beatty) - machten das deutlich. Die wahre Natur des Dollars zeigt sich denn auch in den unzähligen filmischen Pokerrunden. Die ganze Dollar-Ökonomie und mit ihr der amerikanische Way of Life folgte dem befreienden wie schockierenden Prinzip des Glücksspiels. Kurz: Der Dollar steht nicht nur für Geld, sondern für viel, für unendlich viel Geld.
Onkel Dagoberts ekstatische Kopfsprünge in die Berge von Scheinen, die sein "Geldspeicher" enthält, machen sämtliche Kinder der westlichen Welt seit Jahrzehnten damit vertraut. Und wenn sie zu alt für die "Mickey Maus"-Comics sind, erzählt das Kino das Märchen von den mythischen Dollarscheinen weiter.
In jedem dritten Hollywood-Film wechseln Koffer voller Geld die Besitzer. Genau wie für Dagobert, der sein Bad in Banknoten immer als "erfrischend" bezeichnet und dessen Verklärung sich sogar durch die Dollarzeichen in seinen Augen spiegelt, kommt dem durch und durch abstrakten Geld eine physische Qualität zu.
Dollars im Kino beeindrucken nicht durch die Zahl der Nullen, die daraufgedruckt sind, sondern durch Menge und Gewicht. Eines der klassischen Bilder Hollywoods zeigt den Gangster, der einen der vielen Stapel in die Hand nimmt und die Scheine wie ein Daumenkino durch seine Finger laufen lässt. In diesem Moment ist der Traum wahr geworden: Das Geld, das zuvor penibel gezählt werden musste, ist zu einer unerschöpflichen Ressource geworden, wie Luft oder Wasser. Es wird in die Höhe geworfen und schneit wie Konfetti zu Boden.
Der Dollar als Ikone des 20. Jahrhunderts
Doch in dieser ejakulativen Feier des Mythos Dollar zeichnet sich schon die depressive Ernüchterung ab, die folgen muss: Je mehr Geld, desto wertloser ist es und desto überforderter seine neuen Besitzer.
In der Kunst taucht der Dollar schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Motiv auf. Nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs, als die Währung schwächer war denn je, malten Künstler wie William Michael Harnett Dollarnoten in Trompe-l’œuil-Technik, die wirkten, als seien sie schon durch Tausende Hände gegangen - und wurden dafür prompt als Geldfälscher verfolgt.
Viel später, mit der Pop Art, kehrte der Dollar als Motiv zurück. Andy Warhol hatte ursprünglich vorgeschlagen, die Scheine selbst als Kunstwerk aufzuhängen: "Wenn jemand zu Besuch kommt, sieht er als Erstes das Geld an der Wand." Dann druckte er aber doch seine eigenen Exemplare, zum Beispiel "Eighty 2-Dollar Bills, Front and Rear" - ein logischer Schritt, nachdem er Suppendosen und Schachteln von Topfreinigern auf die Leinwand gebracht hatte.
Auch der Dollar ist nur eine Marke, eine graphische Ikone seiner Zeit. Der abstrakte Wert des Kunstwerks überstieg den abstrakten Wert der Banknoten fast augenblicklich. Auch Robert Rauschenberg, Edward Kienholz und viele andere zitieren den Dollar in ihren Werken. Demgegenüber steht die Ikonographie von HipHop und Rap mit ihren Darstellungen eines krassen, provozierenden Materialismus. Das $-Zeichen in Gold wird dort getragen wie einst das Kruzifix.