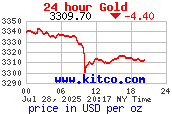In einem Artikel bei der WeltWoche geht es um Insiderverkäufe bei diversen Banken, die von der Hypothekenkrise besonders hart getroffen wurden. Da kommt einem gleich der Spruch "Die Ratten verlassen das sinkende Schiff" in den Sinn - und vor allem auch die Beteuerungen eben dieser Manager noch im Frühjahr / Sommer diesen Jahres, wo noch steif und fest behauptet wurde, dass das alles ja gar nicht so schlimm wäre und alles längst eingepreist sei...
Ich bin ehrlich gesagt zu faul, die entsprechenden Kommentare rauszusuchen und es geht hier auch nicht im "Rechthaberei" - was mir aber wirklich gegen den Strich geht, ist dass diese Leute sich nochmal gerade "rechtzeitig" ihre Aktien "vergoldet" haben - wohlwissend, was da auf "uns" zukommt - und im gleichen Zeitraum von einer "Krise" nix wissen wollten!
Finanzkrise
Manager wissen es besser
Von Claude Baumann
Seit einem Jahr verkaufen einige hochrangige UBS- und CS-Kader Aktien ihrer Banken. Sie haben die Immobilienkrise offenbar kommen sehen.
Von allen europäischen Grossbanken ist die UBS am stärksten von der globalen Finanzkrise betroffen. Kaum kursieren neue Hiobsbotschaften über Verluste bei anderen Geldhäusern, geraten ihre Aktien unter Druck. Anfang dieser Woche büssten die Papiere erneut fünf Prozent ein. Der Befund ist klar: Die Investoren trauen der Schweizer Bank kaum mehr, seit sie im Oktober einen unerwartet hohen Abschreiber von 4,2 Milliarden Franken ausweisen musste und weitere Ausfälle drohen. Die UBS hat ein Reputationsproblem.
Mit dem Vertrauen tun sich indessen nicht nur Investoren schwer. In den letzten zwölf Monaten haben sich auch höchste Mitarbeiter der Bank von ihren UBS-Aktien verabschiedet. Selbst die Chefs scheinen schon früh an der UBS gezweifelt zu haben. Zwischen November 2006 und heute veräusserten Mitglieder der zehnköpfigen Konzernleitung sowie die drei vollamtlichen Verwaltungsräte – oder mindestens eine Person – UBS-Aktien im Wert von rund fünfzig Millionen Franken. Natürlich sind die Manager frei, so zu investieren, wie sie wollen. Zudem müssen auch Grossverdiener gelegentlich Steuern bezahlen, oder sie wollen sich ein Haus oder ein neues Auto leisten. Einige Verkäufe sind auch auf das Verfalldatum von Aktienoptionen zurückzuführen oder auf Leute, welche die UBS verliessen. Trotzdem verwundert die Verkaufswelle. Sahen die UBS-Oberen manche Gefahren schon früher als die Mitarbeiter in den unteren Chargen? Trennten sie sich deswegen von ihren Beständen? Und: Könnten sich Kleinanleger von solchen Transaktionen gar inspirieren lassen? Dazu nimmt die UBS keine Stellung.
Energisch am Werk
Insgesamt erfolgten 16 Verkäufe. Der grösste belief sich auf 17 Millionen Franken. Die anderen bewegten sich zwischen 40000 und 6 Millionen Franken, wie Angaben der Schweizer Börse belegen. Damit vermieden die Banker massive Verluste in ihren Portefeuilles. Denn in den letzten sechs Monaten büsste die UBS-Aktie mehr als dreissig Prozent an Wert ein.
Gekauft haben die UBS-Topleute dagegen bloss zweimal: Ein nebenamtlicher Verwaltungsrat bezog im Dezember 2006 den ihm zustehenden Betrag von 250000 Franken in Aktien, und erst wieder Anfang dieses Monats kaufte ein weiterer nebenamtlicher Verwaltungsrat Aktien für 1,1 Millionen Franken.
Auch die Chefs der zweiten Schweizer Grossbank, Credit Suisse (CS), bewiesen ein Sensorium für die Entwicklungen an den Finanzmärkten. Fairerweise muss man ihnen zugute halten, dass sie ihre Transaktionen – wir wollen sie nicht Panikverkäufe nennen – zurückhaltender tätigten. Die CS verzeichnete im selben Zeitraum nur 12 Verkäufe im Wert von 28 Millionen Franken. Und dies, obwohl im Frühjahr der charismatische CEO Oswald J. Grübel in Rente ging und manche Mitarbeiter hätten annehmen können, der Konzern habe vorerst den Zenit überschritten. Offensichtlich traute die Führungscrew der CS-Aktie auch in der Nach-Grübel-Ära weiteres Potenzial zu.
Viele Topbanker vergleichen sich gerne mit Unternehmern und rechtfertigen so ihre hohen Löhne. Doch der Vergleich hinkt, wie der Blick auf die Transaktionen bei der UBS und der CS zeigt. Unternehmer würden in schwierigen Zeiten niemals eigene Aktien verkaufen: Es wäre der schlagende Beweis dafür, dass sie den Glauben an ihr Unternehmen verloren haben. Viele Industrielle nützen Börsenbaissen eher dazu, Aktien günstig zu erwerben. So baute etwa der deutsche August Baron von Finck sein Grossengagement beim Genfer Warenprüfunternehmen SGS zu tiefen Kursen laufend aus; ähnlich verhalten sich beispielsweise die Schweizer Unternehmer André Kudelski oder Willy Michel bei seiner Firma Ypsomed. Auch der amerikanische Grossinvestor Warren Buffett kauft in turbulenten Zeiten unterbewertete Aktien – im Moment auch Bankentitel – und ergänzt so sein Portefeuille Berkshire Hathaway. Er orientiert sich an der Substanz eines Unternehmens, an dessen Dienstleistungen und Produkten, an Patenten und Immobilien. Der Kurs an der Börse ist für ihn bloss eine Momentaufnahme, die von kurzfristigen Spekulationen getrieben ist.
Vor diesem Hintergrund hätte die UBS Potenzial. Die Bank erzielt in ihrem Kerngeschäft, der Vermögensverwaltung, nach wie vor hohe Erträge. Selbst in einigen Bereichen des krisengeschüttelten Investmentbanking ist das Institut erfolgreich: im Aktienhandel oder in der Beratung von Firmen bei Fusionen und Übernahmen. Unternehmerisch spräche also einiges für den Kauf von UBS-Aktien. Zudem will die Bank für das schwierige Jahr 2007 an einer unveränderten Dividende festhalten. Das würde den Anlegern nun eine Rendite von vier Prozent bescheren. Im Vergleich: Der Zins auf dem Sparkonto beträgt 0,875 Prozent.
Die Frage ist, ob nicht noch neue Hiobsbotschaften die Pläne der UBS durchkreuzen könnten. Die Kreditkrise ist nicht ausgestanden. Anfang Woche erklärte das New Yorker Analysehaus Credit Sights, die Schweizer Grossbank könnte neun Milliarden Dollar in komplexen Finanzinstrumenten in den USA verloren haben. Am Dienstag dann reduzierte noch die Finanzanalystin Meredith Whitney ihre Bewertung für die UBS. Ausgerechnet sie. Die Expertin der Canadian Imperial Bank of Canada hatte vor zwei Wochen schon die Citigroup in Bedrängnis gebracht. Whitney bezifferte die Abschreiber der weltgrössten Bank im Detail und löste damit eine Unternehmenskrise aus. Citigroup-Chef Charles Prince musste gehen. Nun erwartet Whitney, dass die UBS 2008 wegen anhaltender Turbulenzen dreissig Prozent weniger Gewinn erzielen wird.
Verwaltungsratspräsident Marcel Ospel hat jüngst mehrmals eingeräumt, dass die UBS die grösste Krise der letzten Jahre durchmache und nun alles daransetze, die Reputation wiederherzustellen. Die rasche Neubesetzung des vakanten Vizepräsidentensitzes könnte eine Chance sein, nachdem der Mandatsträger Marco Suter als Finanzchef in die Konzernleitung relegiert wurde. Normalerweise wird der neue Vizepräsident nach der Generalversammlung im Frühjahr bestimmt. Daran will sich die UBS halten. Doch manche Anleger fragen sich, ob man so lange zuwarten kann. Sie fordern, dass Sergio Marchionne eine wichtigere Funktion übernimmt. Der Manager ist hauptamtlich CEO bei Fiat, sitzt aber seit April 2007 auch im Verwaltungsrat der UBS. Insider attestieren ihm die Energie, um die UBS wieder auf Kurs zu bringen. Vorerst wollen aber weder er noch die UBS dazu Stellung nehmen. Fest steht: Wenn sich bis im Frühjahr die Situation nicht verbessert hat, müssen die Verantwortlichen die Strategie überdenken – was nicht ohne personelle Konsequenzen vonstatten ginge. Spätestens dann könnte Marchionnes Stunde schlagen. Vorerst aber will die UBS am 11. Dezember in London die Finanzgemeinde über den Geschäftsgang im vierten Quartal informieren. Dann hat sie Gelegenheit, Signale des Vertrauens auszusenden.