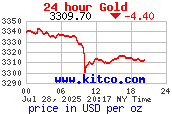Gefunden bei der wiwo.de:
Alles ist teurer
Zu Besuch bei US-Konsumenten.
Immokrise und Ölpreisschock – wie reagieren die US-Konsumenten, die Stütze der Wirtschaft? Zu Besuch bei einer typischen Familie.
Pelican Road in Smithtown, eine Stadt auf Long Island mit gut 100.000 Einwohnern. Platanen säumen die Allee, in den Einfahrten vor den ein- oder zweigeschossigen Häusern stehen Ford-Pickup-Trucks oder Chrysler-Minivans. Vor vielen Häusern weht die amerikanische Flagge. Hier leben junge Familien mit Kindern. Halbwüchsige Jungs versuchen sich mit ihren Skateboards an gewagten Sprüngen. So etwa muss man sich die typische amerikanische Mittelstandsidylle vorstellen.
Die Frau vom US Postal Service dreht mit ihrem weißen Lieferwagen die Runde. Oft bringt sie Rechnungen, oft nimmt sie Schecks in den Umschlägen wieder mit. In den USA wird noch viel mehr per Scheck beglichen als in Deutschland.
Es ist keine arme Gegend. Die Familien, die hier wohnen, gehören nicht zu den 36 Millionen Amerikaner, die nahe oder unterhalb der Armutsgrenze leben.
Und doch sind sie es, die den Produzenten, den Importeuren, den Händlern, den Ökonomen und den Spekulanten an der Wall Street zurzeit die meisten Sorgen bereiten. Denn diese Familien machen mit ihren Ausgaben für Lebensmittel, Kleidung, Autos, Elektronikartikel, Restaurantbesuche und Ferien rund zwei Drittel des amerikanischen Bruttoinlandsproduktes aus. Die amerikanischen Verbraucher waren in den vergangenen Jahren das Rückgrat der US-Wirtschaft, ja sogar der Weltwirtschaft. Trotz der stark gestiegenen Energie- und Nahrungsmittel und trotz deutlich höherer Zinsen für Hauskredite und Kreditkartenschulden haben diese Familien ihre Konsumausgaben bisher nicht entscheidend eingeschränkt.
Doch wird das so bleiben? Pelican Road Nummer drei. Hier wohnen Pete und Juliann Raso mit ihren beiden Kindern Pete junior, acht, und Anthony, der sechs wird. Pete ist Mechaniker, er arbeitet bei der New Yorker Müllabfuhr. Jeden Morgen fährt er eine Stunde die 80 Kilometer über den Long Island Expressway nach Queens, um die schweren Trucks zu reparieren, die nachts die Müllsäcke in den Straßen New Yorks einsammeln.
„Ein guter Job“, sagt Pete, „er wird gut bezahlt.“ Rund 70.000 Dollar verdient er im Jahr. Er arbeitet da schon zwölf Jahre, er und seine Familie sind krankenversichert. Keine Selbstverständlichkeit in Amerika, wo fast ein Drittel der Bevölkerung keine oder nur eine unzureichende Absicherung im Krankheitsfall hat. Nach 25 Dienstjahren wird Pete sogar eine Pension von der Stadt bekommen.
„Trotzdem ist es härter geworden in den vergangenen Jahren“, sagt seine zwei Jahre jüngere Frau Juliann. Die größte Sorge der Familie? Pete lacht ein wenig gequält: „Immer der nächste Monat.“ Bevor sie hierhin zogen, kalkulierten die beiden genau, ob sie sich das Haus wirklich leisten konnten. Da sie ihr altes Haus mit etwas Gewinn verkauften, brauchten sie nur einen Kredit über 180.000 Dollar. Trotzdem zahlen sie alles in allem jeden Monat rund 3000 Dollar für das Haus – Zinsen für die Hypothek, Steuern und Versicherungen. Das ist mehr als die Hälfte von Petes Bruttogehalt, und, schlimm für die beiden: Inzwischen ist die Kalkulation „mit einem großen Krach zusammengebrochen“.
Denn praktisch alles ist teurer geworden als geplant. Dabei gehören die Rasos nicht zu jenen naiven Hauseigentümern, die sich von halbseidenen Beratern undurchsichtige Darlehen andrehen ließen, deren Belastung plötzlich in die Höhe schnellte. Pete hat die Zinsen auf 15 Jahre fixiert. Die Subprime-Krise betrifft ihn nicht. Aber die Steuer für das Haus kletterte von 6300 Dollar auf 10.300 Dollar – um mehr als 60 Prozent. Noch stärker stieg der Preis für Heizöl. Im ersten Jahr kostete die Gallone 1,19 Dollar, heute verlangen die Händler mehr als das Doppelte, 2,60 Dollar.
Die amerikanische Notenbank Federal Reserve hat vor Kurzem die Zinsen gesenkt, um die Unternehmen und Konsumenten wie die Rasos zu entlasten. Doch bei ihrer Inflationsmessung klammert die Federal Reserve die Preise für Nahrungsmittel und Energie aus – weil sie zu sehr schwanken und das Bild verzerren würden.
Darüber können Pete und Juliann nur lachen. Für sie sind das keine Schwankungen, sondern ein eindeutiger Trend: nach oben. Petes magere Lohnerhöhungen reichen nicht mehr aus, um die steigenden Energiekosten und Lebensmittelpreise aufzufangen. Viele Amerikaner, besonders in der Mittelklasse, haben in den vergangenen Jahren real Einkommenseinbußen hinnehmen müssen. „Für Lebensmittel haben wir vor zwei Jahren rund 400 Dollar im Monat ausgegeben“, sagt Juliann, „heute sind es eher 600 Dollar.“ Als sie vor sechs Jahren hierhin zogen, zahlte Pete pro Monat rund 200 Dollar für Benzin, heute sind es etwa 120 Dollar pro Woche.
Auch der Strom ist deutlich teurer geworden. Im bunten Glasleuchter über dem Esstisch steckt deshalb eine Energiesparbirne. Zum Glück ist der Sommer jetzt vorbei, die Rasos brauchen die Klimaanlage nicht mehr. „Im Winter kann man ja noch einen Pullover mehr anziehen“, sagt Pete.
Juliann spart beim Einkauf. „Ich achte mehr auf Sonderangebote, und einige Sachen sind einfach nicht mehr drin, Shrimps oder Krabben sind einfach zu teuer für unser Budget.“ Statt Cola und Sprite müssen die Jungs Leitungswasser trinken. Das sei ohnehin gesünder. Und wie früher einmal die Woche mit Freunden ausgehen? „Wir machen eher Barbecue im Garten“, sagt Pete.
Um vier kommt der Bus, der die Jungs von der Schule heimbringt. Pete junior übt auf dem Rasen Handstand und Radschlagen. „Er ist so ein guter Turner“, sagt die Mutter stolz, es sei wirklich schade, dass sie sich den Gymnastik-Trainer nicht leisten könnten. Aber der Karate-Kurs für die Jungs, der 267 Dollar im Monat kostet, sei noch nicht gestrichen.
Papa Pete steckt außerdem jeden Monat rund 200 Dollar in einen Sparplan, der den Jungs später den Besuch eines College ermöglichen soll. „Wenn es so weit ist, werde ich hoffentlich das Haus abbezahlt haben, das wird uns etwas Luft verschaffen, wenn alles wie geplant läuft.“ Wenigstens muss er sich um seinen Job keine Sorgen machen, Müll wird es immer geben.
Doch ein neues Auto? Im Moment absolut nicht drin. Pete will dafür nicht noch mehr Schulden aufnehmen. Seine Kreditkartenrechnung begleicht er jeden Monat komplett, nicht wie viele seiner Kollegen und Nachbarn, die immer nur den Minimalbetrag zurückzahlen und so mehr und mehr Schulden auftürmen, bis irgendwann gar nichts mehr geht.
Die einzige Kreditkarte der Familie ist von der Disney Corporation und erfüllt einen weiteren Zweck: die Finanzierung der gemeinsamen Ferien. „Wir sammeln mit jedem Einkauf Punkte“, sagt Juliann. Vor einigen Jahren hat das Paar 20.000 Dollar in einen Time-Sharing-Plan des Vergnügungskonzerns investiert, zusammen mit den Kreditkartenpunkten reicht es für einen jährlichen Urlaub in einem der Disney-Resorts. Im vergangenen April waren sie in Orlando in Florida, den Jungs hat es riesig gefallen. Für Pete war der Kauf der Time-Sharing-Beteiligung ein gutes Geschäft, heute würde derselbe Anteil 26.000 Dollar kosten. Noch bis ins Jahr 2058 können sie mit Mickey Mouse Urlaub machen.
Um die Finanzen der Familie aufzubessern, startete Juliann gemeinsam mit Freundinnen aus der Nachbarschaft ihr eigenes „Business“: Sie lädt Frauen zu Handtaschen-Partys ein, nach dem Vorbild der Tupperware-Treffen. Unter dem Label „Hopeful Stars“ bietet sie in China gefertigte Taschen an. Seit einem Jahr arbeitet Juliann an dem Projekt, auch eine Web-Site hat sie schon installiert, das Interesse sei sehr groß. Viel herausgesprungen für die Haushaltskasse ist dabei allerdings noch nicht.
Gut, wenn man Familie hat, die einspringt, wenn Not am Mann ist. „Ja, wir danken Gott für Grandma“, sagt Pete. Die wohnt bei den Rasos und zahlt von ihrer Rente eine kleine Miete, einen Zuschuss fürs Familienbudget.
Und wie wird das nächste Weihnachtsfest aussehen – werden die Rasos für Geschenke genauso viel ausgeben wie in den Vorjahren? Der amerikanische Einzelhandelsverband hat in der vergangenen Woche eine düstere Prognose abgegeben, er rechnet mit geringeren Ausgaben fürs Fest.
Doch auf die Rasos scheinen sich die Händler und damit die Produzenten, die Importeure und auch die Spekulanten an der Wall Street verlassen zu können. „Wir werden sicher nicht mehr Geld fürs Fest haben, aber wir versuchen, es auf dem Niveau vom vergangenen Jahr zu halten“, sagt Juliann, „schon wegen der Jungs.“
[09.10.2007] andreas.henry@wiwo.de (New York)
Aus der WirtschaftsWoche 41/2007.